Projekte zwischen Wissenschaft, Kirche, Kunst und Medienwelt
-

Aktuelle Tanzangebote 2024
Ich liebe es zu tanzen! Was das für mich bedeutet, habe ich hier schonmal beschrieben. Außerdem gebe ich die Freude am Tanzen gerne weiter. Aktuell gibt es folgende Tanzmöglichkeiten mit mir. Sag es gerne weiter oder melde dich an: Rock’n’Roll (9er-Schritt, Tanzfiguren, Choreografien, Akrobatiken, Shows) Zouk/Salsa/Bachata (Führen & Folgen, Footwork, Musicality, Styling) Gesellschaftstanz (Standard/Lateinamerikanischer Tanz)…
-

Ein Regen-Camino an der portugisischen Küste
Einleitung Ich war im Sep/Okt 2024 auf dem portugisischen Jakobsweg unterwegs. 280 Km von Porto bis Santiago. Mein fünfter Camino insgesamt und der zweite nach Santiago de Compostela. Und wieder war es ein faszinierendes Erlebnis mit tollen Begegnungen und viel Zeit zum Nachdenken und Entspannen. Körperlich sicherlich immer eine Herausforderung, aber ich weiß mittlerweile, dass…
-

Funktionieren lokalisierte fiktionale Inhalte?
In den letzten Wochen habe ich die Serie „Perfekt verpasst“ auf Amazon Prime gesehen. Eine lustige Kleinstadt-Comedy über zwei Singles, die sich zufällig niemals treffen, obwohl sie ständig im gleichen Umfeld unterwegs sind. Das ist witzig durchdacht, bildtechnisch schön gestaltet und an einem Abend/Wochenende leicht rezipierbar. Marburg ist dabei Ort der Handung und gleichzeitig auch…
-

rp24 – Ist die re:publica der bessere Kirchentag?
Das war eine volle Woche! Erst war ich 3 Tage in Berlin bei der re:publica, einer der größten Digital-Gesellschafts-Konferenzen Deutschlands, danach war der Katholikentag zu Gast in Erfurt. Beides erstaunlich ähnliche Veranstaltungen mit ganz anderem Look & Feel. Ich versuche mal einen Vergleich aus meiner Sicht als Medientheologe. Ich bin ja im Herzen Eventorganisator und…
-
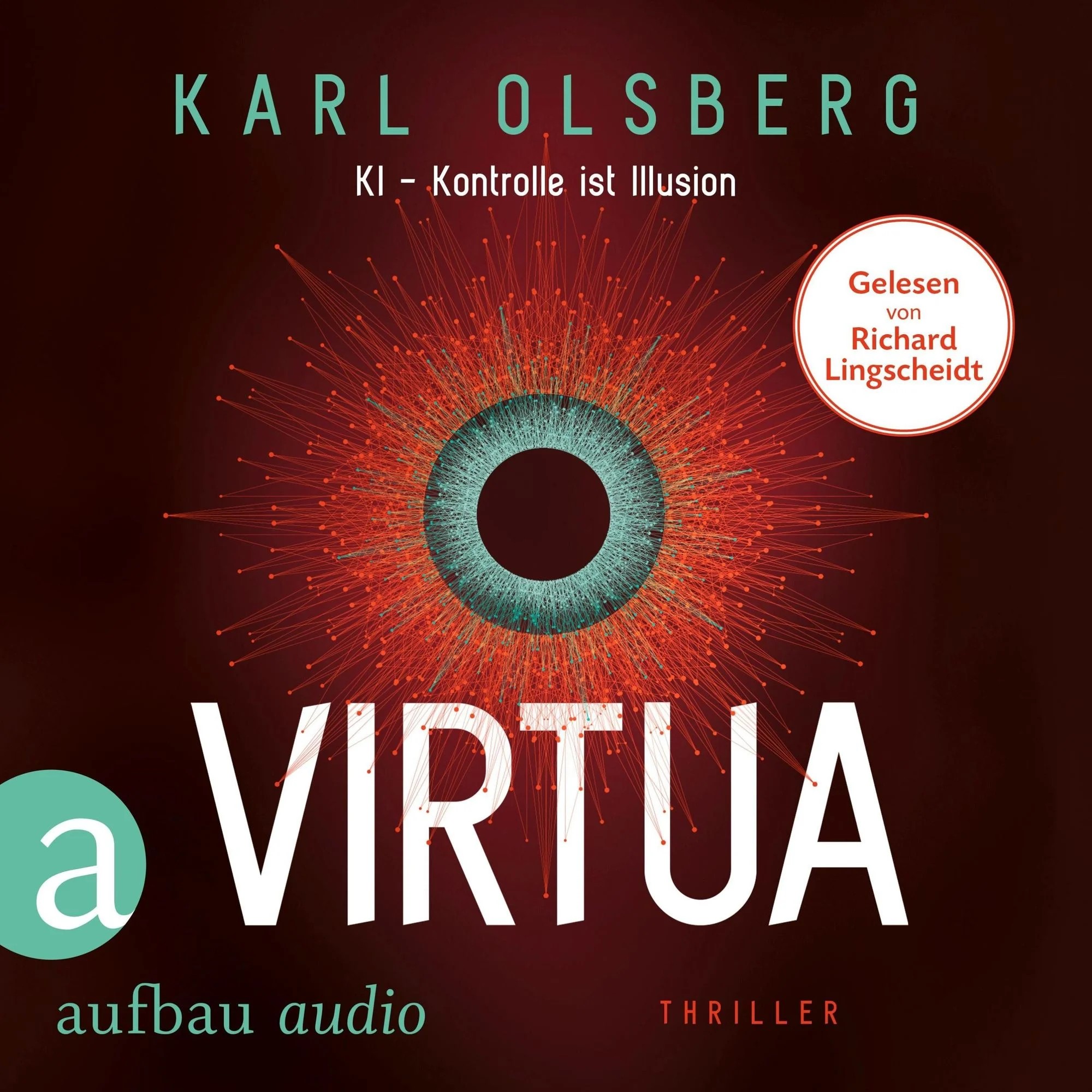
In welcher (virtuellen) Welt wollen wir leben?
Kürzlich hab ich Karl Olsbergs Roman „Virtua. KI – Kontrolle ist eine Illusion“ (2023) gelesen bzw. gehört und bin fasziniert von den durchaus auch religiös-philosophischen Fragen, die der Autor uns stellt. Ein wenig erinnert seine Welt an die Utopie von „Qualityland“, mit einer Entwicklung von „The Circle“ und „Operation Naked“ mit einer Tendenz zur „Westworld“-Paradies-Perspektive…
-

Digitalisierungs-Bullshit-Bingo
Vor einiger Zeit habe ich eine Visitenkarte entwickelt, die auf der Vorderseite die üblichen Daten trägt und auf der Rückseite den freien Platz für ein wenig Gamification nutzt. In einem 4×4-Raster stehen Begriffe und Schlagworte, die bei vielen Vorträgen in meiner Bubble immer wieder fallen. Sei es als platte Hülse, als reflektierter Diskurs oder um…
-
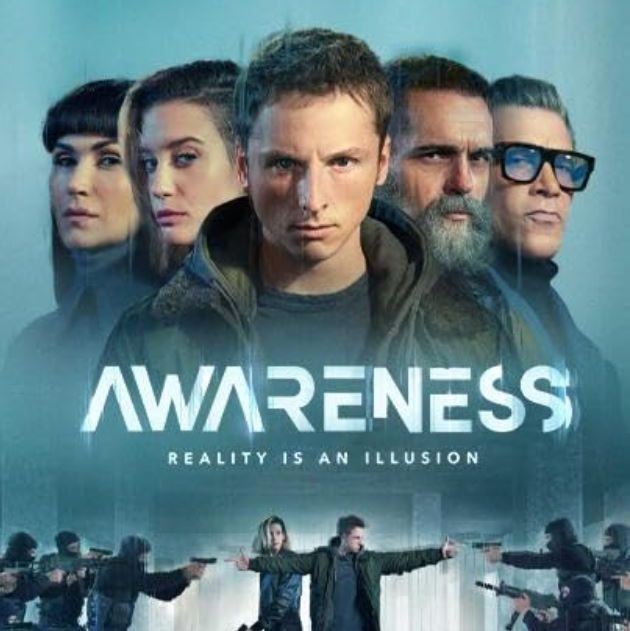
Awareness – Was denkst du, ist real?
Heute möchte ich über den Film „Awareness – Die Realität ist eine Illusion„ sprechen. Seit Oktober 2023 auf Amazon Prime als Stream verfügbar wurde er mir öfters angeboten, aber ich habe ihn mehrfach weggeklickt. Noch so ein Superpower-Fantasy-SciFi-Thriller mit Effekthascherei dachte ich. Als ich den Film dann doch mal gesehen habe, war ich sehr positiv…
-
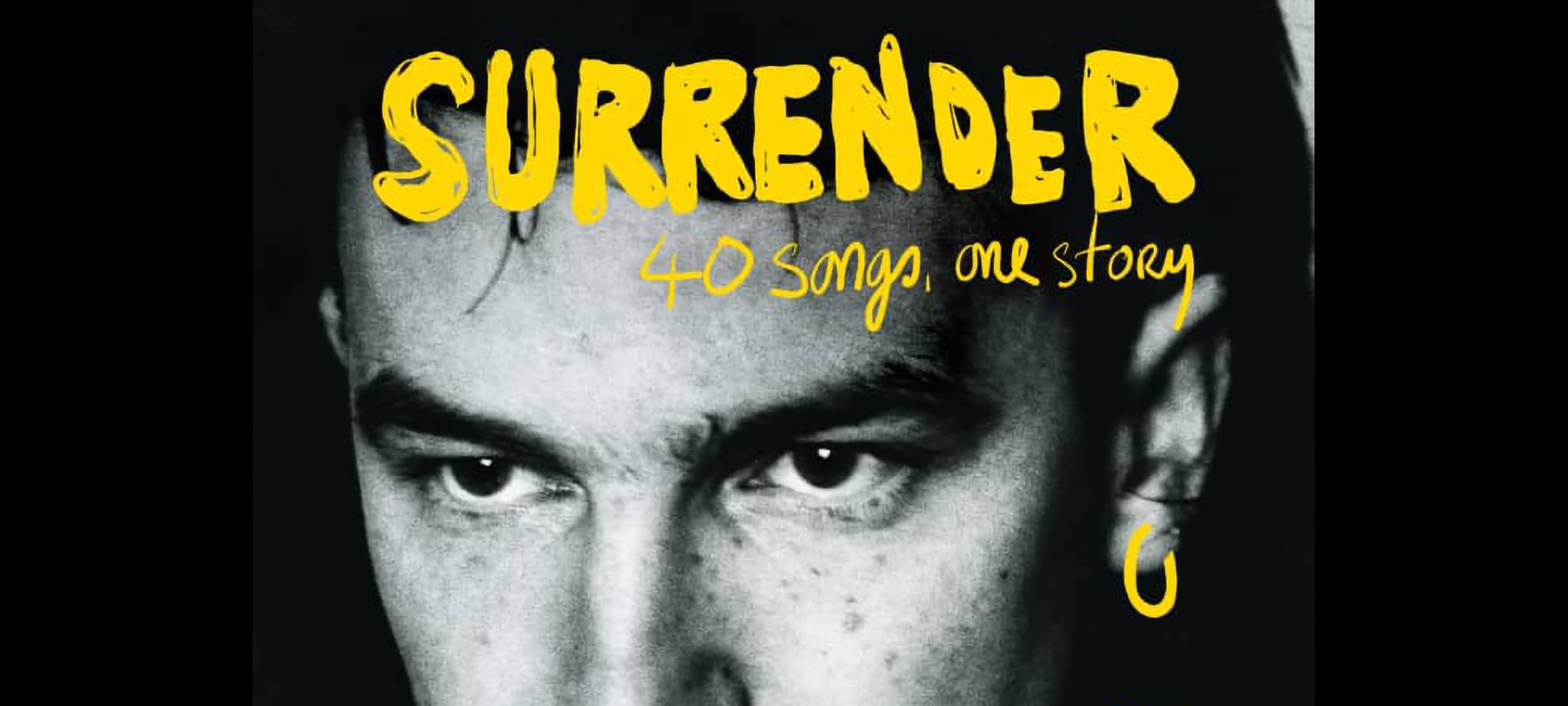
Surrender – I did it – U2?
Ich hoffe, ihr verzeiht das platte Wortspiel im Titel, aber es liegt auf der Hand, das Bono bei der Benennung seiner Autobiographie (und dem dazugehörigen Album) ganz ähnlich gedacht hat. Im irischen Dublin mit katholisch-anglikanischen Eltern aufgewachsen war der Sänger vom konservativen Christentum geprägt, erzählt von religiösen Erfahrungen und zitiert in jedem Kapitel zahlreiche Bibelverse.…
-

Paradise & Arcadia (& Interstellar & Cloudatlas) – Wie aktuelle Filme sich das Paradies vorstellen
In der letzten Woche habe ich mich zufällig mit vier filmischen „Paradiesvorstellungen“ beschäftigt, die eigentlich gar keine sind. Spannend, dass religiöses Vokabular einer (vergangenen) perfekten Welt genutzt wird, um (zukünftige) Horror-Welten zu zeigen. Ein Schöpfergott bleibt dabei weitestgehend außen vor. Viel mehr geht es um menschliche Abgründe und innerweltliche „Erlösungswünsche“, „Opfer“ und „Versuchungen“. Als erstes…
-

„Fake oder Liebe“ – Trash-TV offenbart Vertrauensverlust durch Deepfake-Medien
„Falso Amor“ (dt. Fake oder Liebe) ist eine spanische Netflix-Produktion, die das alte BigBrother-Überwachungs-Konzept mit Flirtshow und Partyspielen in die KI-Ära transferiert. 5 Paare werden für 2 Wochen getrennt in 2 Traumhäusern untergebracht. Dort wohnen auch noch je 10 attraktive Singles, die versuchen, sie in Versuchung zu bringen. So weit nichts Neues. Aber zum ersten…
-

Kann KI Gottesdienst feiern? Gedanken zu einem Experiment beim Kirchentag 2023
Beim Kirchentag in Nürnberg wurde erstmalig ein experimenteller KI-Gottesdienst gefeiert (hier komplett nacherlebbar, hier ein kurzer Einblick in 70 Sekunden als Reel). Nach Einführung ins Konzept und Ermutigung sich trotz aller Skepsis drauf einzulassen waren 45min Zeit für eine Liturgie, die zu 98% von der KI gestaltet war. Der Theologe Jonas Simmerlein hat GPT3 die…
Schlagwort-Wolke Blogbeiträge: (alle durchsuchen)
abstand Berlin Bibel Camino corona erfurt Event Film Gemeinschaft Geschenk Glaube Gottesdienst Hörbuch Jakobsweg KI Kino Kirche Leid Liebe Mediathek Medienkompetenz Musik Netflix Offline Online Ostern party Passion Pilgern re:publica Rezension Rock'n'Roll Rollenspiel Roman Santiago Serie SocialMedia Sucht Tanz Tanzen Theologie VirtualReality Whisky Worship Zoom
Seiten:
>> Wissenschaft >> Kirche >> Kunst >> Medien >> Kontakt
Buzzwordstatement: Praktizierte Medienpädagogik hilft, Medienproduktion zu lernen, durch Medienanalyse Medienkompetenz und Medienkonvergenz zu erwerben, in Crossmedialität Multimedia, Mediadesign, Virtuelle Realität (VR), Augmented Reality (AR = Erweiterte Realität oder Mixed Reality) mit Blended Learning oder Game Based Learning (was nicht das gleiche ist wie Gamification) in Schulungen, Seminaren, Workshops und Modulen zu praktizieren, durch Evaluation, also der Prozess-Auswertung mit wissenschaftlichen Analysen die Umsetzung sowie Forschung & Lehre an einer Universität, Hochschule, oder Fachhochschule als Dozent, Lehrer und Autor mit Erfahrung in TV-Redaktion, Web-Redaktion, SocialMedia-Redakion, Digital-Konzeption, Event-Organisation, Website-Gestaltung, Filmproduktion, Drehbuchevaluation, Formatentwicklung voranzutreiben, um im Community-Management, Marketing, beim Fundraising, Crowdfunding und Recruiting durch Team-Building und Ehrenamtsförderung den Gemeindebau bei Gemeindegründung, Spezial-Gottesdiensten, Zielgruppen-Gottesdiensten, Kreativ-Gottesdiensten, Brunch-Gottesdiensten, Tanz-Gottesdiensten, Sauna-Gottesdiensten, Meditationen, Andachten, Feiern mit progressiver Entspannung, Mental Wellness, Ermutigung, Seelsorge, Begleitung, Coaching, Mentoring, Verkündigung, Moderation und Kleingruppenleitung zu bereichern und dabei verständlich für Menschen, Maschinen und Algorithmen zu bleiben.

