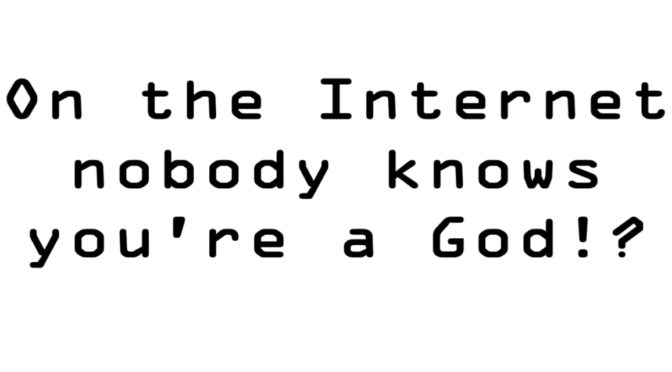Schlagwort: Online
-

Wie funktionieren Hybride Gottesdienste?
Bei einem Gottesdienst treffen sich Menschen in einer Kirche und werden von Theologen bepredigt, von Musikern zum Singen animiert und von Liturgen durch den Gottesdienst geleitet. Das kann inhaltlich und musikalisch ganz unterschiedlich aussehen, lebt aber oft von der Begegnung im gleichen Raum. Durch die Kontaktsperren haben viele Gemeinde statt der Treffen vor Ort auf…
-
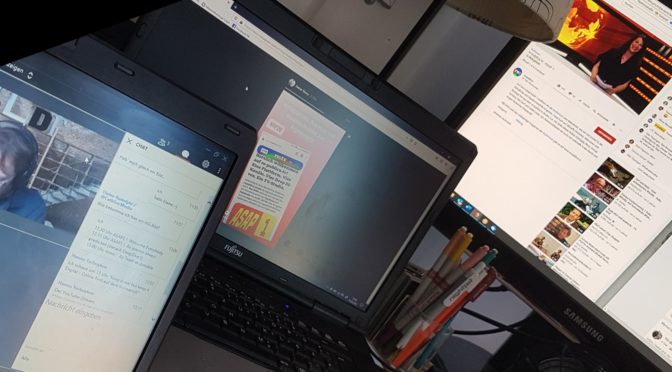
#RPremote – ein kurzes recap
re:ublica, das bedeutet drei volle Tage mit tausenden von Menschen bei hunderten von Veranstaltungen in der „Station“ Berlin. Oft gemeinsames Treffen am Vorabend mit #DigitaleKirche und Freunden und das Kennenlernen zahlreicher neuer Leute. Dieses Jahr war so einiges anders. Ein Rückblick. Schon allein die Anreise war viel kürzer. Mit Hausschuhen aus der Küche zum Schreibtisch…