Schlagwort: Theologie
-
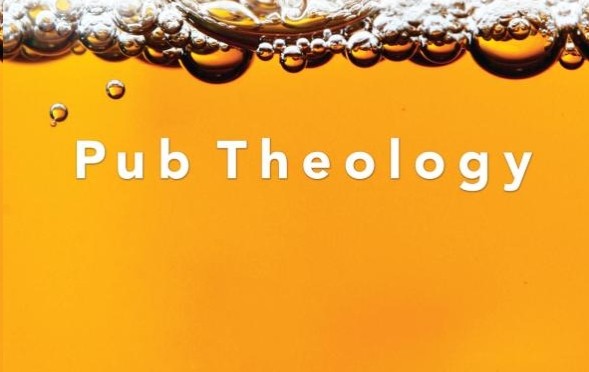
Pub Theology – Buchrezension
Vor kurzem hab ich ein Buch gelesen, das ich schon länger im Schrank stehen hatte. Und es scheint aktuell sehr gut in meine gedankliche Situation zu passen: Bryan Berghoef – Pub Theology. Ein amerikanischer Pfarrer aus streng reformierter Tradition beschreibt darin seinen Glaubensweg von einem dogmengläubigen Mitläufer über die Öffnung für andere Christen im Studium…
-

Was hat Tanzen mit Theologie zu tun?
Was hat Tanzen mit Theologie zu tun? Viel! Im europäischen Gesellschaftstanz schweben Mann und Frau gemeinsam übers Parkett. Die Führende Person (meist Herr) animiert die Geführte (meist Dame) durch gekonnte Impulse zu atemberaubenden Drehungen. Im Rock’n’Roll katapultieren sich die Partner sogar gegen die Erdanziehungskraft in luftigen Höhen. Und selbst beim Freien und flexiblen Disco-Tanz gibt…
