Schlagwort: re:publica
-

rp24 – Ist die re:publica der bessere Kirchentag?
Das war eine volle Woche! Erst war ich 3 Tage in Berlin bei der re:publica, einer der größten Digital-Gesellschafts-Konferenzen Deutschlands, danach war der Katholikentag zu Gast in Erfurt. Beides erstaunlich ähnliche Veranstaltungen mit ganz anderem Look & Feel. Ich versuche mal einen Vergleich aus meiner Sicht als Medientheologe. Ich bin ja im Herzen Eventorganisator und…
-
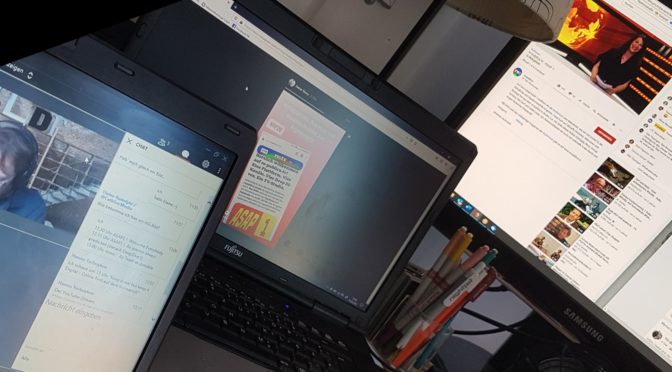
#RPremote – ein kurzes recap
re:ublica, das bedeutet drei volle Tage mit tausenden von Menschen bei hunderten von Veranstaltungen in der „Station“ Berlin. Oft gemeinsames Treffen am Vorabend mit #DigitaleKirche und Freunden und das Kennenlernen zahlreicher neuer Leute. Dieses Jahr war so einiges anders. Ein Rückblick. Schon allein die Anreise war viel kürzer. Mit Hausschuhen aus der Küche zum Schreibtisch…
