Schlagwort: Gottesdienst
-

Wie funktionieren Hybride Gottesdienste?
Bei einem Gottesdienst treffen sich Menschen in einer Kirche und werden von Theologen bepredigt, von Musikern zum Singen animiert und von Liturgen durch den Gottesdienst geleitet. Das kann inhaltlich und musikalisch ganz unterschiedlich aussehen, lebt aber oft von der Begegnung im gleichen Raum. Durch die Kontaktsperren haben viele Gemeinde statt der Treffen vor Ort auf…
-

Geistliches Liedgut im Radiovergleich
Erik Flügges „Kirchenaustritte: Thesen für eine stabilere Kirche“ (20. Juli 2019, primär der vorletzte Absatz) motiviert mich, einen Vergleich christlicher Musik mit der Radiolandschaft zu posten, den ich schon länger im Kopf habe: Wenn in der Kirche Lieder gesunden werden, geht es darum, Gott die Ehre zu geben und sich als Gemeinschaft der Glaubenden gegenseitig…
-
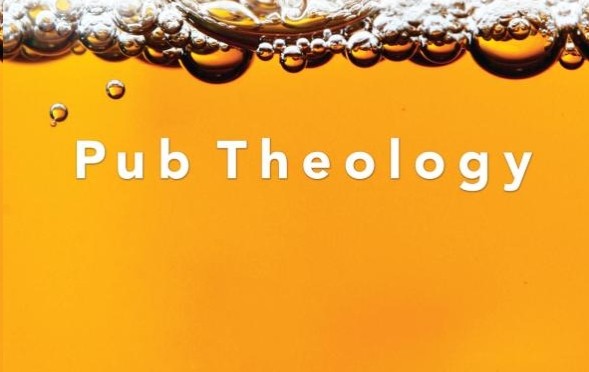
Pub Theology – Buchrezension
Vor kurzem hab ich ein Buch gelesen, das ich schon länger im Schrank stehen hatte. Und es scheint aktuell sehr gut in meine gedankliche Situation zu passen: Bryan Berghoef – Pub Theology. Ein amerikanischer Pfarrer aus streng reformierter Tradition beschreibt darin seinen Glaubensweg von einem dogmengläubigen Mitläufer über die Öffnung für andere Christen im Studium…
-

Sauna vs. Gottesdienst
Ich mag Gottesdiesnt und ich mag Sauna. Wer mit einem davon nicht so vertraut ist, darf gerne mal jemanden fragen, der sich damit auskennt und es ausprobieren 🙂 Im Laufe der letzten Jahre bin ich immer wieder Bekannten aus der Gemeinde in diversen Saunen begegnet. In zahlreichen Gesprächen kam dabei immer wieder zur Sprache, dass…
-

Am Tisch des Herrn
Gestern war ich Diener am Tisch des Herrn. Das war schön. Gleich zweimal. Das war umso besser. Erst haben wir Gottesdienst gefeiert und ich war beim Abendmahl für den „Thekendienst“ zuständig. Also das Auffüllen der Kelche zwischen den Kreisen. Als Erklärung: Wir feiern im Christus-Treff donnerstags einmal im Monat das Abendmahl in Kreisform. Je 30-50…
