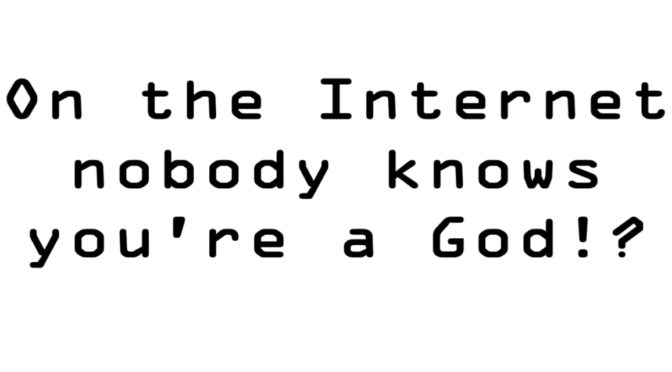Wie verhalten sich Menschen online? Stärkt die intensive Hand-Auge-Koordination das Denken und Verstehen komplexer Zusammenhänge oder vertrödeln wir vor stumpfen Klick-Spielen unsere Zeit, weil wir in Selbstzweifel getrieben werden und nach Bestätigung hungern? Ursprünglich erschienen im Herbst 2016 in einem Beitrag für den theologischen Sammelband „Vielfältige Vernetzung“ zum Thema der KMU V und der daraus resultierenden Folgen. Hier ein zweiter Ausschnitt daraus fürs Web leicht umformuliert (dennoch etwas länger)…
Im Original heißt der Satz „On the Internet, nobody knows you’re a dog” (Im Internet weiß niemand, dass du eigentlich ein Hund bist.) und stammt aus einem Cartoon von Peter Steiner.In der frühen Phase des Internets sollte er ausdrücken, dass man seine Identität online bewusst verfälschend darstellen kann. Mittlerweile ist diese Sichtweise relativiert worden. Die meisten Menschen haben erkannt, dass auch in der Kohlenstoffwelt Kleider Leute machen und dass man sich sehr wohl dem Anlass entsprechend sehr einseitig präsentiert oder sogar falsche Fakten vorspielen kann. In sozialen Netzwerken des Internets besteht ebenso die von vielen Leuten genutzte Möglichkeit, sich selbst ein wenig aufzupolieren oder nur bestimmte Fakten zu nennen und traurige bzw. langweilige Bereiche auszublenden. Wenn man hingegen online mit den Schattenseiten des eigenen Daseins konfrontiert wird, bricht das Kartenhaus leicht zusammen, man geht im Shitstorm unter oder verliert das Selbstwertgefühl, das nötig ist, um sich selber dauerhaft als Marke online zu präsentieren. Allerdings scheinen gerade junge Menschen auf Instagram und Snapchat immer stärker einer Sucht nach Perfektion und Selbstoptimierung zu verfallen und durch die schöpferischen Möglichkeiten der virtuellen Welten wie SecondLife, The Sims oder Minecraft gewisse Allmachtsphantasien zu entwickeln.
 DOGMA – I AM GOD. Spielerischer Spiegeleffekt, gefunden bei der Internetkonferenz re:publica 2016 in Berlin.
DOGMA – I AM GOD. Spielerischer Spiegeleffekt, gefunden bei der Internetkonferenz re:publica 2016 in Berlin.
Das Dogma dieser Generation ist: „Ich bin Gott!“ Alles ist mir möglich, alles sollte erlaubt sein, und wer eine Nutzung einschränkt vergeht sich an meiner künstlerischen Freiheit.
Jeder will für sich herrschen und schöpfen. Das eigene Profil, der eigene YouTube-Kanal und die eigene Minecraft-Map zeigen, was ICH alles kann. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche kooperative Onlinespiele, bei denen man eben nicht als Einzelspieler, sondern in Gruppen (Clan, Gilde, Team, …) zum Erfolg kommt. Ebenso funktionieren viele Arbeitsprozesse der Arbeit4.0 nur partizipativ. Man ist Teil eines Kollektivs, bringt einen Teil ein und sieht das Gesamtwerk wachsen. Und im schlimmsten Falle wird man sogar Opfer des Systems, wenn man nicht richtig funktioniert, nicht die richtige Leistung bringt oder krankheitsbedingt ausfällt und ohne jegliche Emotion durch eine andere Arbeitskraft ersetzt wird.
Das digitale Ich ist also im Netz zunächst virtuell präsent: als autarker Schöpfer, als wichtiger Teamplayer, als austauschbares Rad im Getriebe. Im Internet fängt man als kleines Rad an. Niemand weiß, dass man eigentlich das Potential eines Schöpfers hat, man muss sich beweisen. Durch Eigenleistung kann man sich einen Status erarbeiten, durch Partnerschaften und Allianzen kann man an Bedeutung gewinnen und durch hohes Engagement im richtigen Team letztlich – wenn alles gut geht – die kreative Leistung erbringen, zu der man im Stande ist.
Das christliche Menschenbild baut darauf auf, dass der Mensch als Abbild Gottes tatsächlich mit schöpferischer Kraft ausgestattet ist (Vgl. Genesis 2). Er ist nur wenig geringer als die Wesen in Gottes Realität (Vgl. Psalm 8,6) geschaffen. Wir sind seine geliebten Kinder, durch die er in der Welt wirken will, die ihn nicht kennt. (Vgl. 1.Joh. 3,1) Abseits von egozentrischen Gottphantasien kann also ein christlicher Ansatz den Menschen befähigen, digitale Vernetzung zu nutzen, um sein Potential anzuwenden, und die Welt – online wie offline – zu einem göttlicheren Ort zu machen. Menschen können ein wenig Gott an die Stellen bringen, die sonst von selbstsüchtigem Machtstreben geprägt sind, indem sie die Liebe leben, von denen das Evangelium redet. Menschen können als Vernetzte aktive Nächstenliebe statt Selfisucht leben, flauschen statt shitstormen, andere unterstützen statt sich abzugrenzen, und verstehen statt zu lästern. Das ist nicht immer einfach, oft bedeutet es harte Arbeit. Aber die Kirche wird dann als geistliche Gemeinschaft ernst genommen, wenn ihre Mitglieder von der Masse unterscheidbar leben. Wenn Christenmenschen gegen den Trend soziale Netzwerke wirklich „sozial“ (= dem Gemeinwohl dienend) nutzen, ermöglicht das gleichzeitig ein Wachsen über den Tellerrand hinaus. Und letztlich offenbart jedes Onlineprofil viel vom tatsächlichen Charakter. Wie man sich online gebärdet zeigt, wer sich hinter der physischen Fassade verbirgt. Und wie eine Kirche sich in digitalen Welten einbringt, zeigt wie stark sie von Gottes Botschaft durchdrungen ist.
Im Internet weiß niemand, dass ich ein Gott bin. Im Internet haben Kirchen auch keinen moralischen Vorsprung. Eher werden sie als moralisierende, altmodische Machtinstitutionen gesehen und anhand ihrer aktuellen Skandale – Missbrauch, Protzerei, Spaltungen und Lieblosigkeit – bewertet. Wie wäre es, wenn immer mehr Menschen, Werke und Vertreter der Institutionen ein positives Gegenbild vermitteln würden? Ein Vernetzen im Namen der Liebe, der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit? Dann würde man nicht nur mit Menschen aus der eigenen Konfession Allianzen bilden, nicht nur binnenkirchliche Vernetzung hochhalten, sondern mit allen Menschen guten Willens gemeinsam daran arbeiten, die Onlinewelt zu einem Ort zu machen, an dem Gottes Liebe spürbar ist. Und die Menschen vor den Bildschirmen könnten online erfahren, wie Gottes Liebe aussehen kann und das in ihren physischen Netzwerken weitergeben. So könnte digitale Vernetzung kirchliche Gemeinschaft in allen Dimensionen stärken.